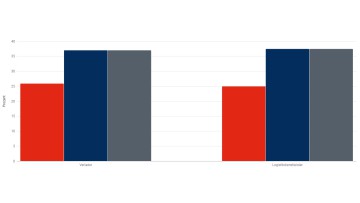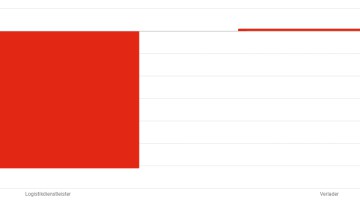Gesundheitsthemen in Unternehmen sind in der Regel in drei Bereiche aufgegliedert:
- Den Arbeitsschutz,
- das betriebliche Eingliederungsmanagement und
- die betriebliche Gesundheitsförderung.
Ein betriebliches Gesundheitsmanagement greift alle drei Bereiche auf und integriert sie in den Unternehmensalltag. Wer dies umsetzen möchte, kann sich an der Norm ISO 45001 orientieren, die auch Anforderungen an das Arbeitsschutzmanagement festlegt. Sie hat inhaltlich unter anderem die DIN-Norm SPEC 91020 abgelöst.
Die betriebliche Gesundheitsförderung ist gesetzlich im fünften Sozialgesetzbuch (SGB V) Paragraf 20b festgeschrieben. Krankenkassen haben demnach die Pflicht, entsprechende Leistungen anzubieten. Sie ist aber nicht verpflichtend für Arbeitgeber. Über das Einkommenssteuergesetz (Paragraf 3, Nummer 34 EstG, Stand April 2025) kann das Unternehmen allerdings hier Steuervorteile nutzen. Mehr Informationen zur betrieblichen Gesundheitsförderung und was die Krankenkassen hier bieten, finden sich in unserem Artikel: Gesundheitsangebote für die Transport- und Logistikbranche.
Gesetzliche Pflichten und Regeln für Arbeitgeber gibt es dagegen für den Arbeitsschutz und das betriebliche Eingliederungsmanagement (mehr dazu in unserem Artikel: Lange krank: Recht auf betriebliche Wiedereingliederung). Während der Arbeitsschutz sich dabei an das Unternehmen ebenso wie an seine Mitarbeitenden wendet, gilt beim betrieblichen Eingliederungsmanagement: Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dieses anzubieten, der Arbeitnehmer muss es aber nicht wahrnehmen, er kann darauf verzichten.
- Überblick Arbeitsschutz-Recht: Vielfältig und zahlreich
- Arbeitsschutz im Detail: Die Arbeitszeit
- Video von WirtschaftsWerkstatt auf Youtube zum Thema:
- Das Arbeitsschutzgesetz: Festgelegte Pflichten
- Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung: Regelmäßiger Check und Dokumentation
- Achtung: Strafen im Arbeitsschutz
- Arbeitssicherheitsgesetz: Mit Experten umsetzen
- Betriebsgröße für Arbeitsschutzausschuss entscheidend
- Arbeitsschutzverordnungen: Eine kleine Auswahl
- Weiterführende Materialien
- Mehr zum Thema Gesundheit am Arbeitsplatz:
Überblick Arbeitsschutz-Recht: Vielfältig und zahlreich
Zum Arbeitsschutz gehört neben der Prävention von Unfällen auch das Verhindern oder Vermeiden von durch die Arbeit verursachten Langzeitschäden. Das deutsche Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und diverse Arbeitsschutzverordnungen unseres Landes basieren auf EU-Recht, unter anderem zählt dazu die EU-Arbeitsschutzrahmenrichtlinie (89/391/EWG) sowie eine Richtlinie zur manuellen Handhabung von Lasten (90/269/EWG).
Konkrete Empfehlungen zu den Anforderungen aus den deutschen Arbeitsschutzverordnungen geben dann wiederum die Technischen Regeln. Diese gibt es unter anderem für Arbeitsstätten (ASR), für Betriebssicherheit (TRBS) und für Gefahrstoffe (TRGS). Sie finden sich auf den Webseiten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Baua). Ein Arbeitgeber hat diese zu beachten, kann aber stattdessen auch gleichwertige Schutzmaßnahmen treffen.
Doch es gibt nicht nur Vorgaben aus Gesetzen, die einzuhalten sind. Denn laut dem siebten Sozialgesetzbuch (SGB VII), insbesondere Paragraf 15, kann auch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) mit ihren branchenspezifischen Berufsgenossenschaften (BG) wie der BG Verkehr (Verkehrswirtschaft, Post-Logistik und Telekommunikation) oder der BGHW (Handel & Warenlogistik) Regeln vorgeben, an die sich die jeweiligen BG-Mitglieder zu halten haben.
Arbeitsschutz im Detail: Die Arbeitszeit

Zum Schutz der Gesundheit zählt außerdem, dass Angestellte nicht zu lange Arbeiten und ausreichend Pausen machen – nicht nur während der Arbeit, sondern auch zwischen den Arbeitstagen oder Schichten. Dafür legt das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) Regeln fest.
Zum Beispiel: Eine durchschnittliche Höchstarbeitszeit des Arbeitnehmers von acht Stunden innerhalb eines halben Jahres, wobei die tägliche Höchstarbeitszeit im Allgemeinen auf zehn Stunden begrenzt ist. Paragraf 7 und 14 gehen auf Ausnahmen ein. Auch für nachts und in Schichten arbeitende Personen macht es Vorgaben, ebenso zur Sonn- und Feiertagsarbeit und zu flexiblen Arbeitszeiten.
Video von WirtschaftsWerkstatt auf Youtube zum Thema:
Für Beschäftigte im Straßentransport gelten zudem Sonderregelungen zur Höchstarbeitszeit (Paragraf 21a ArbZG), ebenso für Binnenschifffahrt, Luftfahrt und öffentlicher Dienst. Die Regelungen zu den Lenk- und Ruhezeiten von Lkw-Fahrern finden sich in der EU-Verordnung EG 562/2006 sowie im Europäischen Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR).
Das Arbeitsschutzgesetz: Festgelegte Pflichten

Eine der wesentlichen Grundlagen des Deutschen Arbeitsschutzes ist aber das Arbeitsschutzgesetz (ArbschG). Für Kinder und Jugendliche unter 18 gibt es gesonderte Arbeitsschutzrechte (Jugendarbeitsschutzgesetz und Kinderarbeitsschutzverordnung).
Im ArbschG festgelegt sind verschiedene Pflichten. Außerdem konkretisieren die DGUV-Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ sowie die dazugehörige DGUV Regel 100-001 die Pflichten noch einmal.
So hat der Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, den Arbeitsschutz in die Betriebsabläufe zu integrieren sowie darauf zu achten, dass diese eingehalten werden. Außerdem muss er Maßnahmen festlegen und umsetzen, die in Notfällen wie etwa einem Brand oder dem Leisten von Erste-Hilfe zum Einsatz kommen.
Bei bestimmten Gefährdungen muss das Unternehmen den Angestellten eine medizinische Vorsorge anbieten, etwa bei Bildschirmarbeit oder Lastenhandhabung. Diese kann zum Teil sogar verpflichtend für die Angestellten sein, etwa bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen oder mit extremer Kältebelastung. Näheres hierzu regelt die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV).
Die Mitarbeiter müssen zudem nach Paragraf 12 ArbSchG eine Unterweisung zu ihren spezifischen am Arbeitsplatz auftretenden Unfall- und Gesundheitsgefährdungen bekommen. Eine Unterweisung zum Verwenden von Arbeitsmitteln – wozu auch Fahrzeuge zählen – hat nach Paragraf 12 Betriebssicherheitsverordnung vor dem erstmaligen Gebrauch und danach mindestens einmal im Jahr zu erfolgen. Sie ist zudem zu dokumentieren. Außerdem ist bei der Unterweisung von Fahrern unter anderem noch die DGUV Vorschrift 70 zu beachten.
Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung: Regelmäßiger Check und Dokumentation
Geht es darum, den Arbeitsschutz im Unternehmen umzusetzen, ist die Gefährdungsbeurteilung ein wichtiger Baustein. Sie wird näher konkretisiert in Paragraf 3 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Neben technischen und baulichen Aspekten spielt dabei auch die psychische Gefährdung der Angestellten eine Rolle.
Eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und ein Arbeitsmediziner ermitteln und beurteilen dabei verschiedene Faktoren und machen Vorschläge für Maßnahmen. Wie der Arbeitgeber diese dann umsetzt, muss er dokumentieren. Die umgesetzten Maßnahmen muss er zudem regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls anpassen.

Wie genau der Unternehmer die Maßnahmen sowie deren Überprüfung dokumentiert, ist zwar nicht vorgeschrieben, aber es muss erkennbar sein, dass sie „effektiv“ durchgeführt wurde. – So heißt es in der Leitlinie Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation von der GDA (Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie).
Über die zuständige Berufsgenossenschaft lässt sich eine Handlungshilfe bekommen. Dabei gilt die Pflicht unabhängig von der Betriebsgröße: Auch Unternehmen mit zehn oder weniger Beschäftigten sind nach DGUV Regel 100-001, Paragraf 3 verpflichtet, die Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren.
Für diese gelten aber Erleichterungen. In der Regel erfüllen sie ihre Pflichten, die Maßnahmen zu dokumentieren, indem sie eine Hilfe zur Gefährdungsbeurteilung der zuständigen Arbeitsschutzbehörde oder des zuständigen Unfallversicherungsträgers nutzen. Zudem müssen sie an der sogenannten Regelbetreuung oder einem alternativem Betreuungsmodell des Unfallversicherungsträgers teilnehmen und die im Rahmen der Betreuung vorgesehenen Instrumente für die Gefährdungsbeurteilung anwenden.
Achtung: Strafen im Arbeitsschutz
Wer gegen die Regeln des Arbeitsschutzgesetzes beziehungsweise einer daraus resultierenden Verordnung mit entsprechendem Bußgeldverweis verstößt oder mögliche Anordnungen der zuständigen Behörde nicht umsetzt, kann nach Paragraf 25 ArbschG mit Bußgeldern bis zu 30.000 Euro bestraft werden (Stand April 2025).
Unter anderem die ArbMedVV hat einen entsprechenden Verweis. Kommt eine vorsätzliche Gefährdung von Leben oder Gesundheit dazu, kann eine Pflichtverletzung nach Paragraf 26 ArbschG auch als Straftat geahndet werden und entsprechend Geld- oder Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr nach sich ziehen (Stand April 2025).
Arbeitssicherheitsgesetz: Mit Experten umsetzen

Die zweite wesentliche Basis im Arbeitsschutzrecht ist das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG). Konkretisiert wird dieses durch die DGUV-Vorschrift 2 (Unfallverhütungsvorschrift "Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit").
Im Prinzip geht es in dem Gesetz um Fragen dazu, wie der Arbeitsschutz im Betrieb zu organisieren ist: Welche Personen hat ein Unternehmen für die Arbeitssicherheit zu beschäftigen oder zu beauftragen? Wie oft haben diese vor Ort zu sein? Zu welchen Anlässen sind sie hinzuzuziehen? Was sind ihre Aufgaben? Wie sieht es mit deren Weisungsbefugnissen aus? Wie unterscheiden sich die Vorgaben je nach Unternehmensgröße?
Laut Gesetz sind Unternehmen verpflichtet, zum einen Betriebsärzte, zum anderen Fachkräfte für Arbeitssicherheit hinzuzuziehen. Je nach Betriebsgröße oder Arbeitsumfang kann auch mehr als eine Fachkraft notwendig sein. Arzt und Fachkraft sollen dem Arbeitgeber helfen und in Fragen beraten, die die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz betreffen. Sie spielen zum Beispiel eine wichtige Rolle bei der vom ArbSchG vorgegebenen Gefährdungsbeurteilung.
Die jeweiligen Berufsgenossenschaften machen hier entsprechende Vorgaben und bieten für kleinere Unternehmen spezifische Modelle an. Diese können sich von den regulären Vorgaben für größere Unternehmen unterscheiden:
- Bei der BG Verkehr zum Beispiel müssen
- Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigen eine Regelbetreuung bestehend aus Grundbetreuung und anlassbezogener Betreuung vorhalten. Die Grundbetreuung, zu der die Gefährdungsbeurteilung gehört, muss für den Güterverkehr spätestens nach drei Jahren wiederholt werden. Zur anlassbezogenen Betreuung zählt neben Änderungen und Neuerungen im Betrieb etwa auch die Beratung der Beschäftigten über besondere Unfall- und Gesundheitsgefahren bei der Arbeit.
- Wer mehr als zehn Mitarbeiter hat, muss eine einheitliche Regelbetreuung, bestehend aus Grundbetreuung und einem betriebsspezifischen Teil umsetzen. Die Grundbetreuung geht hier über die Gefährdungsbeurteilung hinaus und die Einsatzzeit von Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit liegt bei Unternehmen des Straßengüterverkehrs in der Regel bei 1,5 Stunden pro Beschäftigtem und Jahr. Der betriebsspezifische Teil der Betreuung muss bei neuen Vorschriften, die im Betrieb zu Änderungen führen, sowie neuen Erkenntnissen in der Arbeitsmedizin durchgeführt werden.
- Alternativ können Betriebe mit bis zu 30 Beschäftigten ein alternatives Betreuungsmodell wählen. Dies besteht aus Motivations-, Informations- und Fortbildungsmaßnahmen für den Unternehmer sowie einer bedarfsorientierten Betreuung durch Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit. Zu dieser Betreuung zählt wieder unter anderem eine Gefährdungsbeurteilung, der Sicherheitscheck von Anlagen, Neuerungen im Betriebsablauf und gehäuft auftretende gesundheitliche Probleme in der Belegschaft.
- Bei der BGHW können Mitgliedsunternehmen sogar bei bis zu 50 Beschäftigten zwischen einer Betreuung durch Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten als Regelbetreuung und einer alternativen bedarfsorientierten Betreuung inklusive Online-Fernlehrgang wählen. Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern können die bedarfsorientierte Betreuung in dem alternativem Modell anlassbezogen oder auch aufgrund von Beratungsbedarf durch sogenannte Kompetenzzentren durchführen lassen.
Diese Vorgaben gelten unabhängig von arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen, heißt es in der DGUV-Vorschrift. Deren Fristen sind ebenfalls einzuhalten. Vorgaben zu den Vorsorgeuntersuchungen finden sich in der ArbmedVV, die Fristen sind festgelegt in der Arbeitsmedizinischen Regel (AMR) Nr. 2.1, zu finden auf der entsprechenden Seite des Baua.
Das Bundesarbeitsministerium und die DGUV planen laut Aussage von Anfang März 2025, Klein- und Kleinstunternehmen künftig mehr Hilfe beim Arbeitsschutz zukommen zu lassen. Konkret geht es um Pflichten bei der Gefährdungsbeurteilung und Betreuung der Unternehmen durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit und einen Arbeitsmediziner im alternativen Betreuungsmodell. Dazu soll eine überarbeitete Vorschrift 2 erscheinen.
Betriebsgröße für Arbeitsschutzausschuss entscheidend
Außerdem haben Unternehmen weitere Regeln zu beachten, wie zum Beispiel die Südwestfälische IHK zu Hagen auf Ihrer Webseite ausführt. So müssen Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern nach Paragraf 11 Arbeitssicherheitsgesetz einen Arbeitsschutzausschuss bilden, der sich mindestens einmal pro Quartal zusammensetzt.
Im Ausschuss vertreten sind unter anderem etwa der bestellte Betriebsarzt, die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Sicherheitsbeauftragte nach Paragraf 22 des siebten Sozialgesetzbuchs (SGB VII). Denn Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten müssen demnach auch einen Sicherheitsbeauftragten bestellen. Allerdings kann die BG von dieser Regel nach oben und unten abweichen. „Für Unternehmen mit geringen Gefahren für Leben und Gesundheit kann der Unfallversicherungsträger die Zahl 20 in seiner Unfallverhütungsvorschrift erhöhen“, lässt sich beispielsweise im entsprechenden Paragrafen nachlesen.
Der Sicherheitsbeauftragte ist ein vom Unternehmen dafür bestellter Mitarbeiter und übernimmt eine beratende Funktion, indem er etwa Vorgesetzte auf Sicherheits- und Gesundheitsmängel aufmerksam macht und beim Durchführen von Maßnahmen unterstützt.