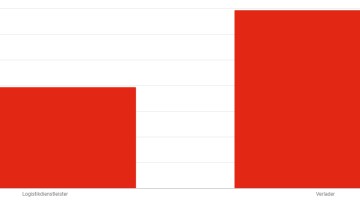Berlin. Man muss davon ausgehen, dass Peter Füglistaler, Direktor des Bundesamtes für Verkehr in der Schweiz, zu der überschaubaren Gruppe von Schweizern gehört, die gern und regelmäßig nach Deutschland reist. Schließlich tritt er hier regelmäßig als Botschafter paradiesischer Verhältnisse auf, zumindest in den Augen von Freunden des Schienenverkehrs. Und dieser Freundeskreis wächst in der Bundesrepublik beständig, weil der Bahn eine Schlüsselrolle zugedacht wird bei der anvisierten Reduktion der CO2-Emissionen im Verkehr. Am Mittwochabend lauschten ihm auf Einladung der Parlamentsgruppe Schienenverkehr gleich der halbe Verkehrsausschuss, weitere Bundestagsabgeordnete, Staatssekretäre und allerlei Entscheider aus der Verkehrsbranche.
Das Publikum wollte wissen, wie es den Schweizern gelungen ist, das nach allgemeiner Einschätzung beste Bahnsystem der Welt zu bauen. Flüglistaler begann seinen Vortrag mit zwei imposanten Zahlen: 14 Prozent des Schweizer Haushalts, das heißt 10,4 Milliarden Franken, fließen jedes Jahr in die Straßen und Schienen. Das entspricht rund der Hälfte dessen, was das deutsche Bundesverkehrsministerium für eine vielfach größere Fläche und Bevölkerung zur Verfügung hat.
Zudem steckt die Schweiz mehr als die Hälfte des Geldes in die Schiene: Aus dem durch Abgaben finanzierten Bahninfrastrukturfonds fließen jedes jährlich sechs Milliarden Franken. Jedes Jahr aufs Neue zu verhandelnde Haushaltspläne entfallen durch die Fonds-Lösung. „Die langfristige Planung - die entspricht etwa dem deutschen Verkehrswegeplan - umfasst sagenhafte 65 Milliarden Franken“, weiß Flüglistaler schon heute. Alle derzeitigen Ausbaupläne sollen 2035 abgeschlossen sein. Er räumte ein, wenn es denn überhaupt ein Problem gibt, dann bei den fehlenden Fachkräften für den Ausbau. Ob Deutschland noch ein paar Ingenieure abgeben könne?
Drei Dekaden Vorsprung
Konstanter Geldfluss, langfristige Planung, klare Priorität für die Bahn: Das ist die Zauberformel, die Füglistaler präsentierte. Einziger Mutmacher für seine Zuhörer: Auch die Schweiz habe mal ein ähnlich schlechtes Bahnsystem gehabt wie Deutschland und dennoch die Wende geschafft. In den 90er Jahren sei das gewesen. Die Schweiz ist Deutschland demnach drei Jahrzehnte voraus.
Die anschließende Podiumsdiskussion machte wenig Hoffnung, dass die Schweiz und andere Länder Deutschland in puncto Schiene nicht noch weiter davoneilen. Denn eine rechte Strategie konnte niemand präsentieren. Als Vertreterin der Bundesregierung betonte die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen, Bettina Hagedorn, dass der Ausbau nicht am Geld scheitere, das die Große Koalition seit 2013 bereitwillig gebe. Der kommende Haushalt sehe noch mehr Geld für die Schiene vor.
Doch: „Die Verkehrsministerien waren in der Vergangenheit immer so aufgestellt, dass das Geld, das das Parlament zusätzlich gegeben hat, in den Bereich Straße gesteckt wurde“, sagte die SPD-Politikerin und reichte den schwarzen Kater so an die CSU-Bundesverkehrsminister der letzten Jahre weiter. Zudem schaffe es die Bahn nicht, zusätzlich zur Verfügung gestellte Mittel auch zu verwenden. „Es ist Fakt, dass die deutsche Bahn jedes Jahr wieder Ausgabenrückstände über 1,5 Milliarden Euro bildet“, sagte Hagedorn.
Wohin mit dem Geld?
„In den letzten drei Jahren sind Ausgabenreste gesunken. Bis 2023, 2024 wollen wir sie ganz weghaben“, verteidigte sich Frank Sennhenn, der Vorstandsvorsitzende der DB Netz AG. Die Bahn könne angesichts enorm langer Planungsvorläufe nun einmal nichts anfangen mit sprunghaft steigenden Budgets, die im Folgejahr wieder zusammengestrichen werden könnten. Zudem habe es nun einmal Zeit gebraucht, die personellen Planungskapazitäten im Unternehmen hochzufahren, sagte Sennhenn.
Das meiste zur Verfügung stehende Geld geht für Erhalt und Ertüchtigung bestehender Strecken drauf. Der Netzausbau kommt hinzu. Wo da aber die Prioritäten liegen, ist ebenfalls umstritten. So kommt die Rheintalbahn zwar voran, doch das Jahrzehnte-Projekt wird kaum für eine schnelle und spürbare Verbesserung im Güterschienenverkehr sorgen. Ähnlich steht es um die Investitionspläne für Knotenpunkte wie Frankfurt am Main: soll kommen, wird dauern.
Viele kleine Störfaktoren im Netz
Hagedorn und die stellvertretende Vorsitzende der Parlamentsgruppe Schienenverkehr, die Linke-Politikerin Sabine Leidig plädierten dafür, sich weniger auf große Prestigeprojekte und Tempostrecken mit 300 Stundenkilometern zu konzentrieren. Stattdessen verdienten die vielen kleinen Störfaktoren im täglichen Netzbetrieb mehr Aufmerksamkeit.
In das gleiche Horn blies Berit Börke, Vertriebsvorstand des Schienenlogistikunternehmens TX Logistik. Es brauche bessere Fahrpläne und Kommunikation sowie mehr Koordinationskapazitäten bei den Infrastrukturbetreibern. Börke war auch die einzige Diskussionsteilnehmerin, die dem Schweizer Modell eines Bahninfrastrukturfonds etwas abgewinnen konnte. „Ich finde diese Idee schon sehr charmant“, sagte Börke.
Das Schlusswort kam dem Gastredner Füglistaler zu, der sich diplomatisch einer Empfehlung zur richtigen Investitionsstrategie enthielt. Vielleicht weil die Strategiefrage allein auch nicht entscheidend ist auf dem Weg zu einem modernen Eisenbahnsystem in Deutschland, mahnte Füglistaler: „Es ist zu wenig Geld im System. Ohne mehr Geld geht es wirklich nicht.“ (sh)